Bildung bleibt.
Prof. Dr. Peter R. Schreiner im Interview über KI in der Hochschule und Wissenschaft
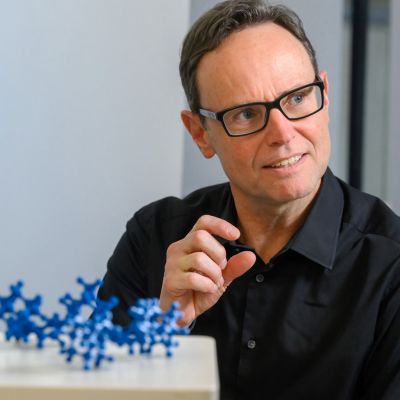
Das ist das erweiterte vollständige Interview, welches in KI-BUZZER Heft#5 im Auszug veröffentlicht wurde. Die neuen erweiterten Fragen sind mit einem Badge markiert: NEU
Wozu noch lehren, wenn ChatGPT längst schneller antwortet? Und wozu noch studieren, wenn der spätere Job vielleicht gar nicht mehr existiert?
Der renommierte Chemiker und Hochschulprofessor Peter R. Schreiner kennt diese Sorgen und begegnet ihnen mit überraschend klarer Zuversicht.
Ein Gespräch über Wandel, Haltung und warum Bildung mehr ist als Wissensvermittlung.
Herr Professor Schreiner, in diesem KI-BUZZER erforschen wir die Schnittstellen von „Bildung und KI“ und beleuchten dabei die Bereiche Lernen, Lehren und Forschen und wie sie sich durch Künstliche Intelligenz verändern. Als Hochschullehrer und aktiver Forscher haben Sie sicherlich einen besonderen Blick auf die Dinge und Ihre Sichtweise möchten wir für die Leserinnen und Leser einfangen.
1. Bildung für die Arbeitswelt der Zukunft
Schätzungen zufolge wird zwei Drittel der Generation Alpha (geboren von 2010 bis 2025) später in Berufen arbeiten, die heute noch nicht existieren. Gleichzeitig könnten durch Automatisierung viele heutige Jobs verschwinden. Da ist es naheliegend zu fragen, ob unser Bildungssystem Studierende auf die richtigen Fähigkeiten vorbereitet.
KI-BUZZER: Lernen wir noch für die richtigen Berufe? Ist es nicht so, dass derzeit eine ganze Generation von Studierenden und Auszubildenden Fähigkeiten und Berufe erlernt, die es in einigen Jahren gar nicht mehr geben wird?
Prof. Dr. Schreiner:
Ein Studium dient oft weniger der Ausbildung für einen speziellen Beruf, sondern vielmehr der Vermittlung wesentlicher Fähigkeiten, wie z. B. analytisches und logisches Denkvermögen, Abstraktionsfähigkeit, Verfassen konstruktiver Kritik, Erarbeiten von Problemlösungen, ethische und moralische Rahmensetzungen u.v.m. – also letztlich vor allem auch der Persönlichkeitsbildung.
Desweiteren ist es so, dass wir ja ein Leben lang lernen müssen, insofern ist das Studium ein Lebensabschnitt, in dem man genau das lernt und ein Leben lang davon zehrt.
Auch die Berufe sind ständig im Wandel – die frühere Vorstellung, dass wir bei einer Firma angestellt werden und dort bis zur Rente immer das Gleiche tun, gehört der Vergangenheit an. Die einzige Konstante ist der Wandel, aber Bildung bleibt.
KI-BUZZER:NEU Abgesehen von diesen wichtigen grundlegenden Problemlösungskompetenzen, welche Skills sind im KI-Zeitalter noch wichtig? Was sollten junge Menschen heute unbedingt lernen, um in einer von KI geprägten Zukunft erfolgreich zu sein?
Prof. Dr. Schreiner:
Manche Studierende fragen mich: ist mein Studium sinnlos, weil mich eine KI später im Beruf ersetzen wird? Ich antworte dann immer: „Nicht eine KI, aber eine Person mit guten KI-Kenntnissen wird Sie ersetzen." Soll heißen: ohne Kenntnisse im Bereich KI wird es schwer werden, auf Dauer in einem anspruchsvollen Beruf zu bestehen.
Darüber hinaus ist die KI nicht gut bei vielen Dingen, die wir Menschen besonders gut können: kreativ sein, neue Ideen entwickeln (vor allem radikal neue „disruptive Ideen"), nicht-offensichtliche Querbeziehungen erkennen, Regeln ableiten, strategisch planen, Emotionen wahrnehmen und auslösen, empathisch handeln u.v.m.
KI-BUZZER:NEU Wünschen Sie sich an manchen Stellen für die Studierenden und für die Universität mehr Unterstützung seitens der Politik? Sind aus Ihrer Sicht sogar Reformen nötig?
Prof. Dr. Schreiner:
Für die Hochschulen sehe ich die Politik weniger in der Pflicht, denn letztlich sind viele sehr nützliche KI-Tools ja alle schon da. Im Augenblick liegt es mehr an uns Lehrenden, diese in Lehre, Lernen und Forschen zu integrieren. Ich baue dabei sehr auf die große Innovationskraft der Hochschulen, die oft von der Politik eher behindert als beflügelt wird. Finanzielle Unterstützung oder wenigstens keine Kürzungen, wie wir sie gerade massiv in Hessen erleben, wäre natürlich sehr willkommen und fördernd!
2. KI im Studium
Die rasante Verbreitung von ChatGPT und anderen großen Sprachmodellen stellt Universitäten vor Chancen und Herausforderungen: Einerseits können KI-Assistenten Studierende beim Lernen unterstützen, andererseits wachsen Sorgen über neue Täuschungsmöglichkeiten.
KI-BUZZER: Verboten oder erlaubt? Wie sollten Hochschulen Ihrer Meinung nach auf Tools wie ChatGPT reagieren? Verbieten, weil die Gefahr von Plagiaten und Betrug besteht, oder integrieren und Lernende in diesem Bereich pro-aktiv unterstützen?
Prof. Dr. Schreiner:
Verbote bringen aus meiner Sicht gar nichts, denn die berühmte Büchse der Pandora ist ja schon geöffnet. Meine Haltung ist hier eindeutig: KI-Tools dort nutzen, wo es sinnvoll ist und transparent angeben, was eingesetzt wurde bzw. was eine Eigenleistung darstellt. Ich schmunzle hier etwas, denn das ist so wie ein „open book exam", das sich leicht anhört, aber am Ende vom Anspruch viel höher ist, als eine Prüfung, zu der man keine Unterlagen mitbringen darf. Ich erwarte also durch Verwendung von KI-Tools an Hochschulen besser ausformulierte Texte, hochkomplexe und tiefgehende Datenanalysen, grafisch anspruchsvolle Präsentationen und vieles mehr: kurzum, eine beachtliche Qualitätssteigerung. Aber dabei müssen wir die Studierenden unterstützen, das passiert nicht von selbst und erfordert fächerspezifische Anpassungen der Lehrinhalte.
KI-BUZZER:NEU Haben Sie schon erste Erfahrungen, die Sie mit uns teilen können? Sehen Sie in KI eher eine Gefahr für die Lernleistung der Studierenden oder ein nützliches neues Werkzeug für einen verbesserten Lernprozess?
Prof. Dr. Schreiner:
Im Bereich Studium sind wir noch in der Findungsphase und ich sehe beides: Studierende, die KI als „Sparrings-Partner" zum Lernen nutzen und dabei eigene Lücken aufdecken und schließen, aber eben auch andere, die diese Lücken einfach nur füllen und hoffen, dass es keiner merkt. Gerade aber in den mathematisch-statistisch affinen Naturwissenschaften sehe ich aber schon eine Qualitätssteigerung bei Datenanalysen und -interpretation. Auch die graphischen Darstellungen haben sich teilweise sichtbar verbessert.
KI-BUZZER: Verändert KI die Rolle der Lehrenden im Hochschulbereich? Wie wird sich das Berufsbild von Dozenten und Lehrkräften verändern, wenn KI einen großen Teil des Wissens vermittelt? Wollen wir die Vortragssäle nicht lieber in Campus-eigene Rechenzentren umbauen?
Prof. Dr. Schreiner:
Eine Lehrveranstaltung dient, so komisch es auch klingen mag, nicht der reinen Wissensvermittlung, sondern ist vielmehr eine Anleitung, wie man sich einem Fach annähert, Inhalte erschließt und hohe Urteilsfähigkeit in diesem Bereich entwickelt. Die eigentliche Wissensaneignung geschieht eher individuell und in der Regel außerhalb des Hörsaals. Insofern müssen wir als Lehrende auch darlegen, wo KI in diesem Prozess unterstützen kann – das machen wir im Augenblick meistens noch nicht sehr gut.
3. KI in der wissenschaftlichen Forschung
Überall dort, wo enorme Datenmengen anfallen, weckt KI die Hoffnung, diese Daten schneller zu analysieren und neue Muster zu entdecken. Auch die Wissenschaft profitiert davon.
KI-BUZZER: Sie setzen KI in Ihrer eigenen Forschung ein. In welchen Bereichen nutzen Sie maschinelles Lernen erfolgreich?
Prof. Dr. Schreiner:
Wir versuchen seit geraumer Zeit, sogenannte „Organokatalysatoren" zu entwickeln oder zu verbessern und da hilft es, Daten, die über die letzten drei Jahrzehnte gesammelt wurden, mittels tiefgehender statistischer Analysen auszuwerten. Ziel ist hierbei, bessere Katalysatoren zu finden, die in kleineren Mengen und unter verringertem Energieverbrauch bei Synthesen von Wirkstoffen und Materialien eingesetzt werden. Das ist ein schwieriges Geschäft, weil die Datenqualität variabel ist, weil sie von Menschen in Experimenten erzeugt wurden. Im Bereich Optimierung von Reaktionsparametern leistet uns die KI schon jetzt gute Dienste, nur bei der Entwicklung gänzlich neuer Reaktionen oder Katalysatoren stehen wir noch am Anfang.
(A. d. Red.: KI-Modelle brauchen saubere, gut strukturierte Daten, um zuverlässig zu arbeiten. In der Forschung kommen Daten oft aus vielen Jahren, von verschiedenen Teams, mit unterschiedlichen Messmethoden. Das ist schwierig unter einen Hut zu bringen. Prof. Schreiner und sein Team bauen sich deshalb Stück für Stück einen eigenen, hochwertigen Datensatz auf – quasi ein Maßanzug für ihre Forschung.)
4. Chancen und Risiken: Löst KI unsere Probleme oder schafft sie neue?
Die öffentliche Debatte über KI schwankt zwischen Euphorie und Apokalypse. In diesem Spannungsfeld den eigenen Standpunkt zu finden ist gar nicht so leicht.
KI-BUZZER: Wird KI helfen, große Weltprobleme zu lösen, wie etwa Ernährung, Medizin oder Energie?
Prof. Dr. Schreiner:
Wie immer kommt es darauf an, was man daraus macht! Gut oder schlecht ist das übliche Dilemma der Chemie: Ammoniumnitrat ist ein extrem wichtiger Dünger, ohne den wir die Welt nicht ernähren können, doch die gigantische Explosion eben dieses Stoffes in Beirut zeigt uns das Janusgesicht chemischer Stoffe – das gilt auch für die KI. Ich habe keinen Zweifel, dass sie uns bei vielen Problemen sehr helfen kann, solange am Ende der Mensch und Menschlichkeit steht.
KI-BUZZER: Beschäftigt Sie auch die Kehrseite? Welche Risiken bereiten Ihnen im Kontext KI am meisten Sorgen?
Prof. Dr. Schreiner:
Natürlich! Blindes Vertrauen und Verwendung von KI ohne Selbstreflexion, eine gewisse Abhängigkeit weil die Datenmengen für Menschen zu groß sind oder werden und den Bereich selbstständige Waffensysteme halte ich für die größten Risiken. Im Bereich Cybersicherheit wird sie uns ebenfalls vor große Herausforderungen stellen.
KI-BUZZER:NEU Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Punkte, die gewährleistet sein müssen, damit KI eher Nutzen bringt als schadet?
Prof. Dr. Schreiner:
1) Transparenz, wenn KI benutzt wird
2) Offenlegung der Trainingsdaten und Algorithmen
3) Umfassende Schulung und Weiterbildung im Bereich KI für alle
5. Tempo der Entwicklung und Anpassungsfähigkeit
Künstliche Intelligenz befindet sich in rasender Entwicklung. Neue Tools und Modellversionen geben sich im Tagestakt die Klinke in die Hand. Das stellt Gesellschaft und Institutionen auf die Probe.
KI-BUZZER:NEU Die KI-Entwicklung galoppiert. Können Bildungseinrichtungen und Politik da überhaupt Schritt halten?
Prof. Dr. Schreiner:
Auf den ersten Blick nur sehr schwer und zeitverzögert. Aber: da es bei der Bildung ja vor allem, wie eben ausgeführt, um Vermittlung bestimmter, grundsätzlicher Fähigkeiten geht, die auf lange Sicht bestand haben, muss man auch nicht jedem Trend nachgehen oder jeder neuen Anwendung hinterherjagen.
KI-BUZZER:NEU Wo sehen Sie die Hochschulbildung in zehn Jahren – insbesondere im Hinblick auf KI?
Prof. Dr. Schreiner:
Es wird wahrscheinlich viel mehr Selbststudium mit KI geben und die Qualität wird sich weiter verbessern. Noch wichtiger aber scheint mir die Stärkung unseres zwischenmenschlichen Wertekanons – gerade weil die KI diesen zwar berücksichtigen, aber niemals empfinden kann.
Fazit
Wer glaubt, KI würde Bildung überflüssig machen, sollte einmal mit Prof. Dr. Peter R. Schreiner sprechen. Er gehört zu jenen Stimmen, die Wandel nicht nur beobachten, sondern aktiv mitgestalten. Sein Blick auf die Hochschule ist klar: KI kann vieles verändern und verbessern, aber sie ersetzt nicht das, was ein Studium im Kern ausmacht: kritisches Denken, Problemlösungskompetenz und die Persönlichkeitsbildung.
Wir sagen: Danke für dieses inspirierende Gespräch – und für die Erinnerung daran, dass sich vieles verändert, aber Bildung bleibt.
Weitere Stimmen zum Thema "Bildung & KI":
- Bundesbildungsministerin Karin Prien im Gespräch über Chancen und Risiken von KI im Klassenzimmer
- Cornelsen-Managerin und Bildungsexpertin Christine Hauck im Gespräch über die Rolle von KI als Lernbegleiterin und Denkverstärkerin
Highlights:
- Bildung als Konstante im KI-Zeitalter
- Warum Persönlichkeitsbildung bleibt, auch wenn Jobs verschwinden
- KI als Werkzeug, nicht als Ersatz
- Chancen für Forschung und Lehre durch KI
- Risiken: Abhängigkeit, Waffen, Cybersicherheit
- Plädoyer für Transparenz und Werte
- Humorvoller, reflektierter Blick aus der Hochschule
Info Prof. Dr. Peter R. Schreiner
Peter R. Schreiner ist Professor für Organische Chemie und “Liebig-Chair” am Institut für Organische Chemie der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er studierte Chemie in seiner Heimatstadt Erlangen-Nürnberg, wo er 1994 in Organischer Chemie zum Dr. rer. nat. promovierte. Parallel dazu promovierte er 1995 in Computerchemie an der University of Georgia, USA.
Er habilitierte sich 1999 an der Universität Göttingen , bevor er 2002 Associate Professor an der University of Georgia (Athens, USA) und Leiter des Instituts in Gießen wurde. P. R. Schreiner ist gewähltes Mitglied und Senator der Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften, der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Er erhielt die Dirac-Medaille (2003, WATOC), den Adolf-von-Baeyer-Gedächtnispreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker (2017), den RSC-Preis für Physikalisch-Organische Chemie (2019), den Wissenschaftspreis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (2020), den ACS Arthur C. Cope Scholar Award (2021), den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis (2024) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und zuletzt die Schrödinger-Medaille der WATOC (2025).
Er war Gastprofessor am CNRS in Bordeaux, am Technion in Haifa, an der Australian National University in Canberra und an der University of Florida in Gainesville. Seine Forschungsinteressen umfassen die Dynamik organischer Reaktionen und reaktiver Intermediate, quantenmechanisches Tunneln sowie London-Dispersionswechselwirkungen im Bereich der Nanodiamanten und der Organokatalyse. Weitere Informationen finden Sie unter www.uni-giessen.de/schreiner.






